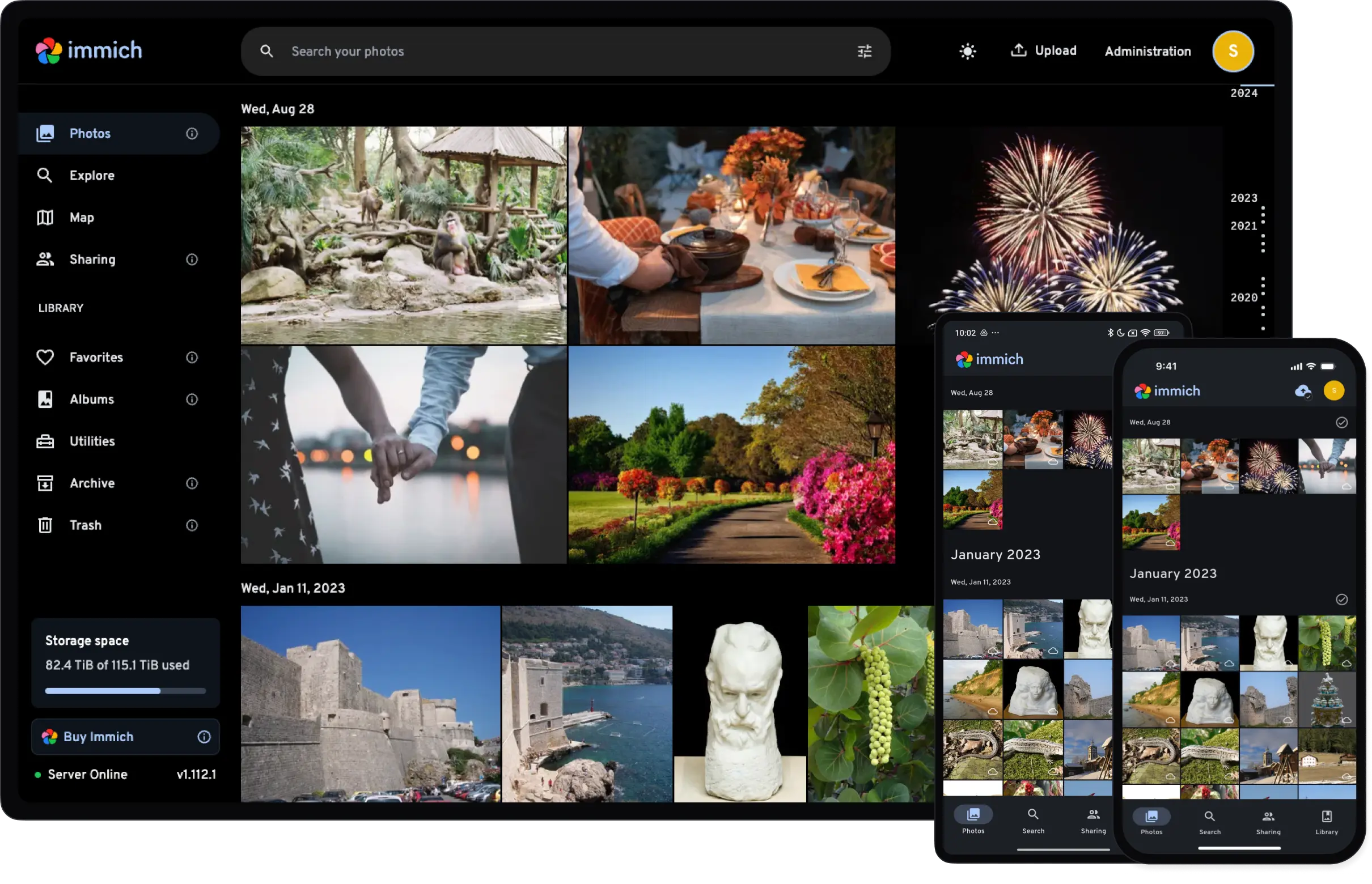Wer sich in #Heidelberg mit dem #Fahrrad bewegt und ein wenig aufmerksam ist, kann schnell bemerken, wo es klemmt. Und es gibt auch gute Stellen, an denen das Radwegenetz vorbildlich und durchgängig ausgebaut ist.
Das Marketing der #Stadtverwaltung ist hierbei gut. Ich wünsche mir, dass sie sich mehr um Problemfälle kümmert. Es gibt einige üble Stellen, die insbesondere für radfahrende Kinder, Jugendliche und Menschen mit körperlichen Einschränkungen gefährlich sind.
Ich meine damit Stellen, die bei Unachtsamkeit, schlechter Sicht und Nässe schnell gefährlich werden können, etwa
- große und tiefe Schlaglöcher,
- Kanten und gefährliche Übergänge an Bordsteinen,
- verkehrstechnisch unübersichtliche Stellen,
- unklare Verkehrsführung,
- Radwege, die einfach enden und
- Wege, die wirken, als hätten Kraftfahrzeuge die Priorität in der Planung.
Heute greife ich einen Bereich in #Kirchheim-West / #Pfaffengrund heraus, an dem es einige unschöne Übergänge für Verkehrsteilnehmer:innen mit dem Fahrrad gibt und wo es bereits zu Unfällen mit Personenschaden kam: den Diebsweg und die Pleikartsförsterstraße, zwischen Baumschulenweg und Im Hüttenbühl.
Die Verkehrssituation Kirchheim/Pfaffengrund hat einen hohen Optimierungsbedarf. Hier sind viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs. Es sind Schulwege, Wege zum Sportzentrum und in andere Stadtteile. Ich beziehe mich auf die wesentlichen Probleme in beide Fahrtrichtungen.
 Bild: Openstreetmap.org unter Open Database-Lizenz
Bild: Openstreetmap.org unter Open Database-Lizenz
Vom Pfaffengrund kommend
Hier gibt es am Diebsweg einen Rad- und Fußweg, der in beide Richtungen benutzt wird.

Kreuzung Baumschulenweg – Diebsweg
Von Kirchheim kommende Fahrzeuge, die nach links in Richtung Pfaffengrund abbiegen, achten auf Fahrräder aus Richtung Pfaffengrund. Der Radverkehr aus Richtung Kirchheim wird häufig übersehen, was zu brenzligen Situationen führt.

Kreuzung Oftersheimer Weg – Diebsweg
Eine Erneuerung der Fahrbahnmarkierung des Radwegs wäre hilfreich.


Kreuzung Speyerer Straße – Diebsweg/Pleikartsförster Straße
Vom ehemaligen Flugfeld kommend endet der Radweg an der Kreuzung und Ampelübergang an der Speyerer Straße. Nach dem Ampelübergang fehlt eine Markierung auf der Straße, die den Radfahrern hilft, sich zu orientieren. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:
Rechts über die Ampel, rechts den Radweg in Richtung Kirchheim-West nutzen.
Rechts über die zweite Ampel, dann links auf die Pleikartsförster Straße. Häufig wird hier aus Sicherheitsgründen der Fußweg gewählt.
Links an der Ampel direkt auf die Fahrbahn und geradeaus auf die Pleikartsförster Straße.
Der Übergang vom Fußweg auf die Pleikartsförster Straße (K9706) fühlt sich an beiden möglichen Stellen unsicher und unschön an. Eine klare Verkehrsführung und Markierung würden helfen.






Pleikartsförster Straße von der Ampel bis zum Kreisel
Die Straße ist stark befahren und die Fahrt auf der Straße ist ist durch mehrere Überholvorgänge von Kraftfahrzeugen und Lastkraftwagen geprägt. Für eine Verkehrsführung der Radfahrer:innen auf der Straße, fehlt eine Fahrbahnmarkierung und eine Geschwindigkeitsbegrenzung.






Pleikartsförster Straße ab dem Kreisel
Auf Höhe der Bushaltestelle beginnt eine Fahrbahnmarkierung für den Radverkehr. Die Geschwindigkeit ist auf 30 km/h begrenzt. Eng wird es durch Überholvorgänge des Busses an der Haltestelle trotzdem.


Der markierte Bereich endet nach der Kreuzung Schlosskirschenweg/Breslauer Straße abrupt und endet in parkenden Autos.


Radfahrerinnen müssen in die Mitte des Fahrbahnbereichs ausweichen und sind einem erhöhten Gefahrenpotenzial durch den entgegenkommenden Verkehr und die von links aus der Breslauer Straße kommenden Fahrzeuge ausgesetzt.


Zwischen Im Hüttenbühl und Albert-Fritz-Straße ist die Situation ähnlich. Auch hier schränken parkende Fahrzeuge die Fahrbahnbreite ein.



Links
Von Kirchheim kommend
Albert-Fritz-Straße – Pleikartsförster Straße
Der Radweg beginnt nach der Einmündung. Er wird ab der Bushaltestelle, neben dem Fußweg geführt. Die Gesamtsituation ist unübersichtlich, wenn Fahrzeuge aus der Albert-Fritz-Straße abbiegen und an der Haltestelle Passanten aus- und einsteigen. Es fehlt eine Fahrbahnmarkierung über die Albert-Fritz-Straße.



Stettiner Straße – Pleikartsförster Straße
Die Überquerung an der Breslauer Straße ist gut markiert. So würde ich mir das an der Einfahrt Stettiner Straße, zum Verkehrsübungsplatz ebenso wünschen.

Pleikartsförster Straße – Kreisel
Kurz nach der Feuerwehr und am ADAC-Gebäude, endet an der Bushaltestelle vor dem Kreisel der Radweg. Der Radweg geht in die Fahrbahn über. Es gibt kein Radweg-Ende-Schild und es fehlt eine weitere Verkehrsführung. Die Situation an dieser Stelle ist unübersichtlich. Es gibt auch Radfahrer, die hier aus Sicherheitsgründen auf dem Fußweg weiterfahren.




Pleikartsförster Straße – nach dem Kreisel
Auf dem Fußweg
Der Großteil der Radfahrer:innen nutzt nach dem Kreisel die Auffahrt auf den Fußweg. Hier gibt es einen ebenerdigen Bereich, der sicher befahrbar ist.
Davor ist ein Bereich, der einen Versatz von mindestens zwei Zentimeter gegenüber dem Fußweg aufweist. Hier kam es bei schlechter Sicht und Nässe mehrfach zu schweren Stürzen.


Der linke, abgesetzte Fahrbahnbereich und die Absenkung der Bordsteinkante vermitteln den Eindruck, es sei ein Radweg. Die Mobilitätszentrale der Stadtverwaltung Heidelberg ist überzeugt, dass dies ausschließlich ein Fußweg sei. Radfahrer sollen auf der Fahrbahn fahren. Quelle: anliegen.heidelberg.de

Auf der Fahrbahn
Nach dem Kreisel ist die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben und ab dem Ortsschild ist 100 km/h erlaubt. Die Ampelsituation und -schaltung an der Speyerer Straße führen dazu, dass Kfz hier stark beschleunigen.
Aufgrund des hohen Verkehrs, der fehlenden Fahrbahnmarkierung und der gefahrenen Geschwindigkeiten gibt es hier ein hohes Gefahrenpotenzial für Radfahrer:innen.



Kreuzung Pleikartsförster Straße – Speyerer Straße
Unmittelbar vor der Ampel kreuzt der parallel zur Speyerer Straße verlaufende Radweg die Pleikartsförster Straße. Hier wäre eine Straßenmarkierung für den Radweg sehr hilfreich.


Weiterhin ist hier nicht klar, wie die Radfahrer günstigstenfalls die Speyerer Straße überqueren sollen, um dann auf den Radweg auf dem Diebsweg zu gelangen. Hier wäre eine sinnvolle Markierung und Verkehrsführung hilfreich.


Vom Radweg Speyerer Straße von der Bahnstadt kommend
Es fehlt eine klare Verkehrsführung und Markierung für Menschen, die auf dem Radweg weiter entlang der Speyerer Straße fahren und sicher die Pleikartsförsterstraße überqueren möchten.
Für die, die in Richtung Kirchheim weiterfahren, fehlt ein klares Konzept:



Links
Wünsche
Ich habe mich in diesem Beitrag mit den wesentlichen Problemstellen in diesem Straßenabschnitt auseinandergesetzt und wünsche mir, dass Verantwortliche daraus ein tragfähiges Konzept erarbeiten und die Sicherheit für Menschen entscheidend verbessern.
Denn es muss nicht erst jemand ernsthaft zu Schaden kommen, bis in Heidelberg verantwortliche Stellen aktiv werden. Ich erinnere an den Vorfall in der Theaterstraße. Es ist Ihre Pflicht, für die Sicherheit zu sorgen, insbesondere auf Schulwegen.
Der Kostenfaktor kann hier kein Argument sein. Für den motorisierten Fahrzeugverkehr wird jährlich ein Vielfaches ausgegeben (Großstädte investieren nur wenig in Sicherheit). Das Sparen darf nicht auf Kosten schwächerer Verkehrsteilnehmer:innen geschehen.
Verantwortlich könnten sich die folgenden Gremien fühlen:
- Amt für Mobilität
- Bezirksbeirat
- Bürgermeister
- Kinderbeauftragte
- Verkehrsverbände
- Stadtteilverein
- Gemeinderat
- Medien


 Hämmerli hebt ab nach dem 2:2 in letzter Sekunde. Interessant sind auch die Reaktionen der Aarauer Zuschauer:innen. (Bild: Gianluca Lombardi.)
Hämmerli hebt ab nach dem 2:2 in letzter Sekunde. Interessant sind auch die Reaktionen der Aarauer Zuschauer:innen. (Bild: Gianluca Lombardi.)