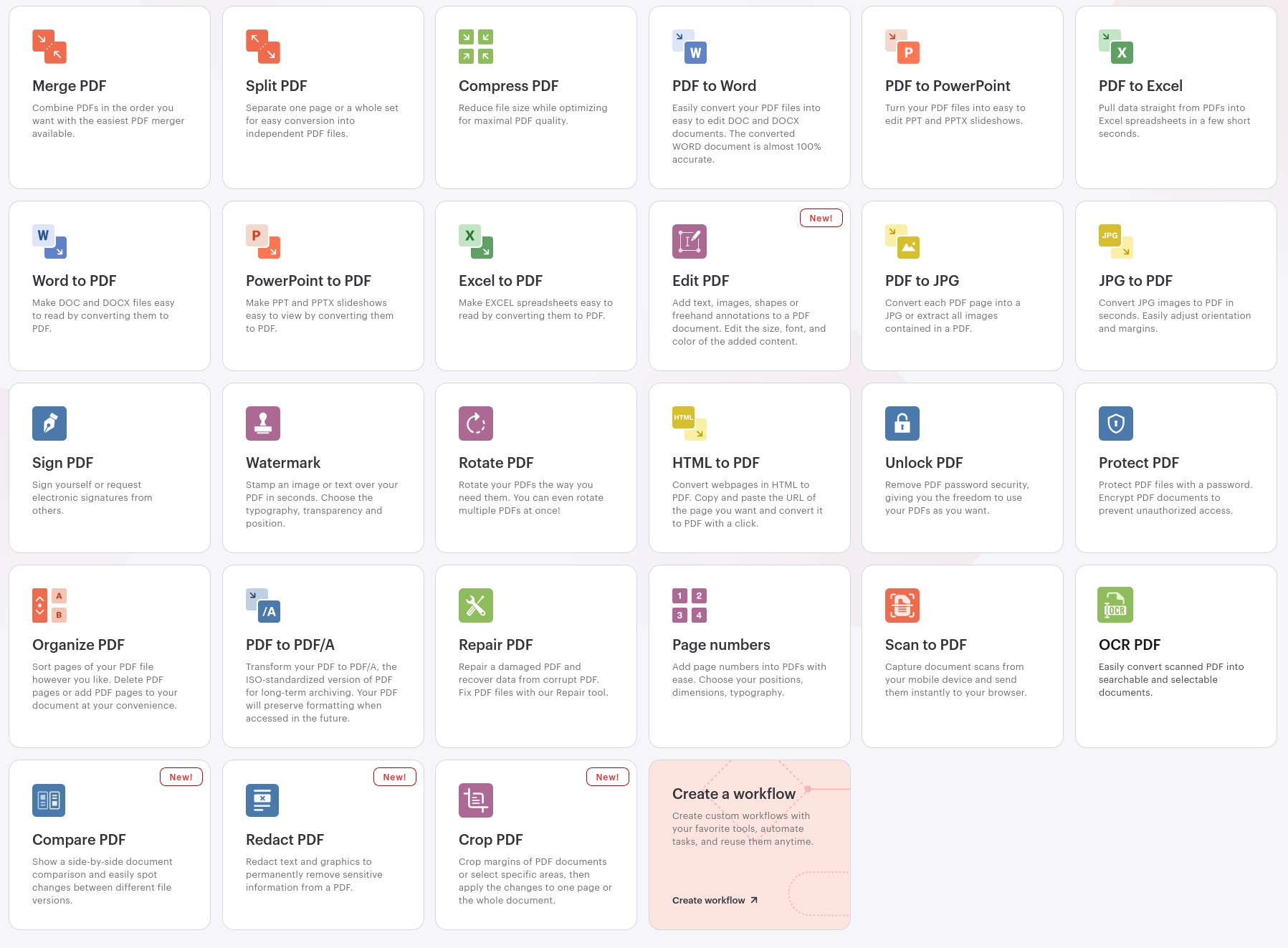Aufgaben- oder ToDo-Listen sind so alt, wie die Arbeitsorganisation selbst. Schon Kinder bekommen Aufgabenlisten, die sie abarbeiten müssen. Jeder Mensch hat in seinem Leben mindestens ein mal eine ToDo-Liste geschrieben.
Die Aufgaben dabei einfach auf ein Blatt Papier zu schreiben und nach Erledigung die entsprechende Aufgabe durchzustreichen ist dabei die einfachste Methode. In unserer heutigen Zeit hat sich aus dieser einfachen Möglichkeit ein ganzer Markt an verschiedenen Apps und Lösungen entwickelt. Neben digitalen ToDo-Listen, die die verschiedensten Tags, Prioritäten und Unteraufgaben zulassen haben sich noch Kanban-Boards und viele andere Möglichkeiten dazugesellt.
Ich glaube es ist schon fast 10 Jahre her, als ich das erste mal in einem Podcast von Ivan Blatter von der Time Blocking Methode gehört habe. Dabei geht es im Prinzip darum, dass jeder Aufgabe auch die Zeit zugewiesen wird, die wahrscheinlich für die Erledigung erforderlich ist. Für die festgelegte Dauer wird dann ein Termin im Kalender eingetragen, in dessen Zeit dann die Aufgabe erledigt wird.
Klingt in der Theorie gut, hat in der Praxis für mich bisher noch nicht funktioniert, da mir oftmals ungepante Aufgaben dazwischen kamen und alles andere über den Haufen geworfen haben.
Warum aber fange ich jetzt wieder damit an? Wegen einem Prompt, der mir heute zugespielt wurde. In diesem Prompt geht es darum, dass aus den vorhandenen Aufgaben ein Tages- bzw. Wochenplan erstellt werden soll. Dafür wird eine entsprechende Aufgabenliste übergeben, die auch angaben zur Dauer der Erledigung (Aufwand) enthalten soll.
Da in meiner Aufgabenliste nur selten der Aufwand für eine Aufgabe angegeben ist, es aber durchaus Sinn ergibt, bin ich über Umwege wieder auf das Time Blocking gestoßen.
Jetzt möchte ich mir aber grundlegendere Gedanken über eine mögliche Aufgabenverwaltung machen.
Was ist eine Aufgabe?
Eine Aufgabe ist eine abgrenzbare zu erledigende Einheit, die ein bestimmtes Ziel oder Ergebnis hat.
Das bestimmte Ziel oder Ergebnis ist klar. Bei der Aufgabe “Müll raus bringen” ist das Ergebnis, dass der Müll draussen in der Tonne ist. Abgrenzbar bedeutet, dass die Aufgabe einen Anfang und ein Ende haben muss. Dazwischen liegt dementsprechend der Aufwand.
Der Müll sollte in ca. 10 Minuten erledigt sein.
Daraus wäre zu folgern, dass eine Aufgabe mindestens Angaben zum Ergebnis oder Ziel und dem zu erwartendem Aufwand benötigt.
Aufgabenplanung
Viele mir bekannte Aufgabenlisten sind sehr lang und werden immer länger. Das Problem dabei ist häufig, dass viele Aufgabenlisten eher eine Art Erinnerungsliste sind. “Diese Aufgaben muss ich irgendwann mal angehen”. Aus der Bullet Journal Method habe ich gelernt durch Reflexion zu entscheiden, ob eine Aufgabe noch den Wert hat übertragen und weiterverfolgt zu werden. Wie sie es wert ist, dann muss auch irgendwann Zeit für die Erledigung eingeplant werden.
Jetzt besteht die Möglichkeit nach der Medium Method die drei wichtigsten Aufgaben des Tages auf einen Post-It zu schreiben und zu versuchen, sie an diesem Tag zu erledigen. Manchmal klappt das, manchmal aber auch nicht.
Bei der Planung, wann ich eine Aufgabe mache, spielen noch mehr Faktoren als der Aufwand eine Rolle. Natürlich ist der Aufwand eine primäre Größe bei der Entscheidungsfindung. Schließlich kann eine Aufgabe, die 2 Stunden Zeit in Anspruch nehmen wird, nicht in den 30 Minuten zwischen zwei Meeting erledigt werden.
Dazu kommt noch die Schwierigkeit oder Komplexität dieser Aufgabe in Bezug auf mein Energiefenster. Eine schwierige und komplexe Aufgabe werde ich sehr wahrscheinlich nicht mehr gut am Ende eines Tages und während des Mittagstiefs erledigen können. Es gilt jetzt also den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe mit dem Energielevel in Einklang zu bringen.
Fassen wir nochmal zusammen:
Die Aufgabe bringt mit
– das Ziel oder Ergebnis
– den Aufwand
– den Schwierigkeitsgrad
Zur Planung der Aufgabe muss es passen zu
– freien Zeiten im Kalender
– persönlichen Energielevel
Bei Getting Things Done von David Allen wird noch empfohlen ähnliche Tätigkeiten zu clustern. Beispielsweise sollten zu erledigende Anrufe direkt hintereinander erledigt werden, was noch eine weitere Ebene der Komplexität in der Aufgabenplanung einführen würde.
Wie kommt das jetzt alles zusammen?
Der bereits von mir erwähnte Prompt, bezieht einige genannte Punkte mit ein. Vorraussetzung dafür ist jedoch, dass die nötigen Informationen vorhanden sind. Wenn diese Informationen bereits bei der Erfassung von Aufgaben berücksichtigt werden, bräuchte es einen solchen Prompt nicht.
Und jetzt kommt die Frage alles Fragen: Gibt es bereits eine Aufgabenverwaltung, die alle erwähnte Faktoren berücksichtigt?
Auf die schnelle habe ich Tiimo und WeekToDo gefunden. Auf den ersten Blick kann bei Tiimo der Kalender integriert werden, sodass diese App schon recht nah dran kommt. Ob sich dort der Aufwand der Aufgabe auf die Planung im Kalender niederschlägt, habe ich (noch) nicht herausfinden können. Die Entwicklung der App scheint auch den Bach runter gegangen zu sein.
Vielleicht gibt es ja eine solche Anwendung (am besten noch Open Source) oder vielleicht habe ich hier einen Samen für künftige Entwicklungen gepflanzt, wer weiß.